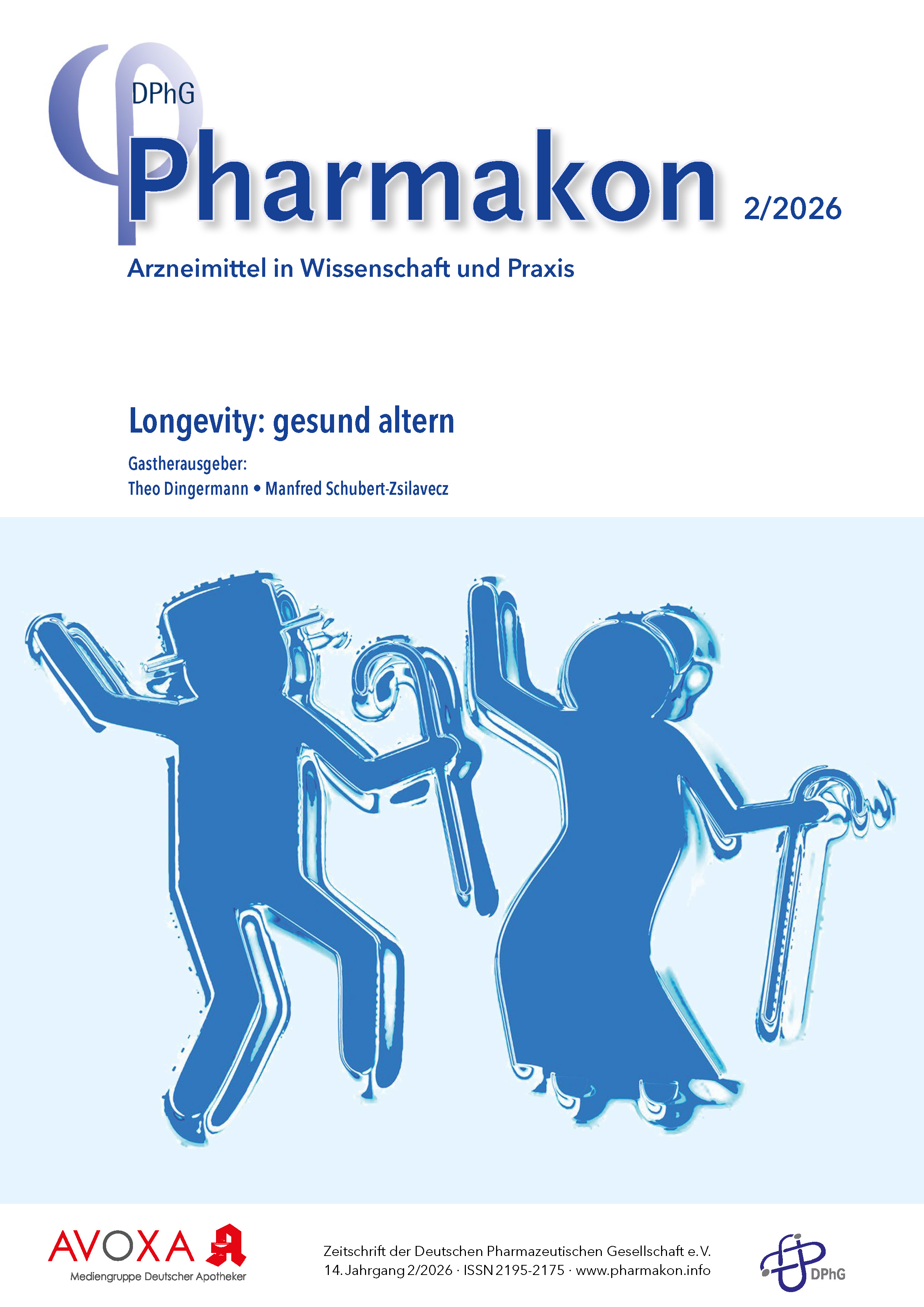Stellungnahme der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft zu den vom Bundesministerium für Gesundheit vorgelegten Referentenentwürfen für
· das Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz – ApoVWG) sowie
· die Zweite Verordnung zur Änderung der Apotheken- betriebsordnung und der Arzneimittelpreisverordnung.